Plazebos für uns schreibende Zunft
Journalisten sind genau wie alle anderen nicht vor Plazebos gefeit. In diesem Fall sind es „große medizinische Studien“, die in „renommierten Fachmagazinen“ wie The Lancet, The New England Journal of Medicine oder JAMA veröffentlicht werden.
Sie bieten uns offenbar immer häufiger nicht das, was wir so gerne verabreicht bekommen: Die Wahrheit über die Wirksamkeit eines Wirkstoffs oder Medikaments. Das sagt Richard Smith in einem Artikel, der einem ein bisschen den Glauben an renommierte medizinische Fachzeitschriften nehmen kann (jetzt nicht gleich verzagen).
Smith muss ja wissen, wo von er spricht. Er war 25 Jahre Redakteur beim British Medical Journal (BMJ) und hat sich 13 Jahre davon auch um die „profits“ der gesamten Verlagsgruppe gekümmert. Sein düsteres Fazit dieser Zeit: Medizinische Fachzeitschriften sind inzwischen der verlängerte Marketing-Arm der Pharmafirmen.
Pharmafirmen wissen, welche Überzeugungskraft ein positives Ergebnis einer großen, gut angelegten Studie hat. Und das Geld und das Know how dafür haben sie auch, schreibt Smith im frei zugänglichen Fachmagazin PloS Medicine. Wenn Pharmariesen Millionen von Dollar ausgeben, dann soll es sich auch lohnen. Untersuchungen zeigen, dass die Mehrheit der Firmen finanzierten Studien zugunsten des Geldgebers ausfallen, also die Wirksamkeit eines Medikaments belegen.
Wie das gelingt? „Nicht etwa durch Manipulation und Fälschung, das wäre zu plump und könnte auffliegen“, schreibt Smith. „Sie stellen die ‚richtigen’ Fragen.“ Smith liefert auch gleich eine Liste der Methoden, wie man durch die ‚richtigen’ Fragen die richtigen, positiven Antworten erhält.
Beispiel: „Lege deine Studie multizentrisch an, und suche dir das Ergebnis aus, das dir am besten passt.“ Angenehmer Nebeneffekt: Gibt es mehrere positive Studien, kannst Du Sie gleich in mehreren Magazinen veröffentlichen.
Smiths Folgerung: Erstens sollten viel mehr Studien mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Und: „Fachmagazine sollten die Studien nicht veröffentlichen, sondern kritisch über sie berichten.“
Wie gesagt: Nicht verzagen.
...........................................................................................
Sie bieten uns offenbar immer häufiger nicht das, was wir so gerne verabreicht bekommen: Die Wahrheit über die Wirksamkeit eines Wirkstoffs oder Medikaments. Das sagt Richard Smith in einem Artikel, der einem ein bisschen den Glauben an renommierte medizinische Fachzeitschriften nehmen kann (jetzt nicht gleich verzagen).
Smith muss ja wissen, wo von er spricht. Er war 25 Jahre Redakteur beim British Medical Journal (BMJ) und hat sich 13 Jahre davon auch um die „profits“ der gesamten Verlagsgruppe gekümmert. Sein düsteres Fazit dieser Zeit: Medizinische Fachzeitschriften sind inzwischen der verlängerte Marketing-Arm der Pharmafirmen.
Pharmafirmen wissen, welche Überzeugungskraft ein positives Ergebnis einer großen, gut angelegten Studie hat. Und das Geld und das Know how dafür haben sie auch, schreibt Smith im frei zugänglichen Fachmagazin PloS Medicine. Wenn Pharmariesen Millionen von Dollar ausgeben, dann soll es sich auch lohnen. Untersuchungen zeigen, dass die Mehrheit der Firmen finanzierten Studien zugunsten des Geldgebers ausfallen, also die Wirksamkeit eines Medikaments belegen.
Wie das gelingt? „Nicht etwa durch Manipulation und Fälschung, das wäre zu plump und könnte auffliegen“, schreibt Smith. „Sie stellen die ‚richtigen’ Fragen.“ Smith liefert auch gleich eine Liste der Methoden, wie man durch die ‚richtigen’ Fragen die richtigen, positiven Antworten erhält.
Beispiel: „Lege deine Studie multizentrisch an, und suche dir das Ergebnis aus, das dir am besten passt.“ Angenehmer Nebeneffekt: Gibt es mehrere positive Studien, kannst Du Sie gleich in mehreren Magazinen veröffentlichen.
Smiths Folgerung: Erstens sollten viel mehr Studien mit öffentlichen Geldern bezahlt werden. Und: „Fachmagazine sollten die Studien nicht veröffentlichen, sondern kritisch über sie berichten.“
Wie gesagt: Nicht verzagen.
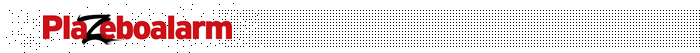
Koppelgeschäfte und die Grenzen von Peer Review
Auch auf die berüchtigten Koppelgeschäfte weist Smith hin. Durch diese können die Firmen den Zeitschriften und deren Verlagen nochmal richtig viel Geld als Dankeschön rüberschieben: Ist das Paper erfolgreich plaziert, werden üppig Sonderdrucke des Artikels geordert.
Der New Scientist sieht das so: "Peer review usually fails to expose these tricks, [Smith] says. And there can also be a financial incentive for journals to publish privately funded studies: the companies involved often order thousands of reprints, which is highly lucrative for the journals. Smith argues that more trials need to be publicly funded, while the results of those that are paid for by companies should be published only on regulated websites, not in journals."
New Scientist vom 21. Mai 2005
Leider wollte keiner Stellung beziehen: "None of the other medical journal editors contacted by New Scientist would comment."
Smith stellt sich ganz auf die Linie von Plazeboalarm. Die Journals sollten die Studien nicht publizieren, sondern als Diskussionsplattform die Ergebnisse kritisieren und zerpflücken.