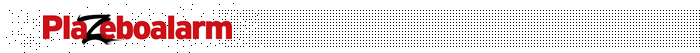Also jetzt mal Butter bei die Fisch`.
(
Leute, das wird verdammt lang´, nehmt euch etwas Zeit.)

Einfach nur ein Mineralwasser zu sein, reicht ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr, um den Durst der Konsumenten zu stillen. Hipp und well muss es sein, mit Zitronenspritzer oder nicht, nicht nur Durst löschen soll es, sondern fit machen (
Sauerstoffwasser ist ja nur die Spitze des Eisbergs).
All das nennt man wohl die Diversifizierung eines Produktes.
Ein Wasser aber war ja schon immer etwas besseres, das verkündete schon der Name: Staatlich Fachingen, äh Fachinger, quatsch, Fachingen,
Staatl. Fachingen.

Es war nie die selbsternannte "
Queen of tablewater" (
die inzwischen auch auf Vitamine setzt), sondern eher so was wie das "
Kanzler unter den Mineralwässern".
Davon hat der Produzent lange gezehrt. Bis jetzt.
Einfach nur ein Wasser zu sein, reicht auch Fachinger nicht mehr. Staatl. Fachingen macht jetzt auf Wissenschaft, genauer: Staatlich Fachingen macht schöne Haut, wissenschaftlich bewiesen, in der ersten "neutralen wissenschaftlichen Studie". (
Wie nennt man das, wenn jemand von einem weißen Schimmel spricht? Ein Pleonasmus, genau, danke, setzen. Obwohl ... ?!)
Also, dann:
Die Staatl. Fachingen-Haut-Studie. (
Zum Thema Neutralität und Sponsoring wissenschaftlicher Studien, bitte einen Beitrag tiefer lesen).
Wir haben
Fachinger natürlich angeschrieben, und ausführlich Auskunft bekommen (danke an Frau Silvia Erbrich, die Marketing Managerin).
Sie hat uns das abstract (die Zusammenfassung) der Untersuchung geschick, die unter der Leitung von Frau
Martina Kerscher durchgeführt wurde. Sie ist die Leiterin des Studienganges
Kosmetik und Körperpflege an der Universität Hamburg.
Und Sie selbst sagt - nicht uns, sondern laut der Werbung - über ihre eigene Studie:
"Das Resultat der Studie ist bemerkenswert. Das untersuchte Mineralwasser hat eine nachweisbare, positive Wirkung auf die Haut."
Na dann.
Folgendes hat Frau Kerscher und ihre Mitarbeiter gemacht: 53 Personen haben vier Wochen lang jeden Tag 2,25 Liter (das sind drei Flaschen Wasser á 0,75 Liter) getrunken. (Drei Personen sind vorzeitig ausgestiegen, bleiben 50 Personen).
Dann hat sich Frau Kerscher und ihre Mitarbeiter die Haut der Probanden angesehen (mit entsprechenden Instrumenten und Verfahren).
Fazit:
"Die Ergebnisse sprechen für sich:
Ultraschallmessungen zeigen eine signifikante Veränderung der Haut."
Und das hat Folgen (positive natürlich), wie es weiter heißt, denn:
- Die Haut sieht praller und frischer aus. Die Haut weist eine geringere Fältelung auf und wirkt dadurch glatter.
- Der pH-Wert der Haut nähert sich dem optimalen Wert für die Hautoberfläche von 5,5 an. Das kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu stabilisieren.
Dazu der Faltenvergleich, den ihr oben beispielhaft im Bild seht.
Ein Blick in das abstract überrascht uns dann:
Das einzige, was statistisch signifikant war (also nicht zufällig) war die Hautdichte.
Ansonsten:
"Skin surface pH and skin surface morphology did not change significantly."
Der pH-Wert der Haut hat sich nicht verändert, die Hautmorphologie (Rauhigkeit, Fältelung) auch nicht.
Auf unsere Nachfrage lautet die Antwort:
"Die Veränderungen bezüglich der Rauhigkeit waren nicht signifikant, wir sahen jedoch die Tendenz zu einer glatteren Haut. (Anmerkung von uns: selbe Begründung für pH-Wert). Bei kleineren Fallzahlen verhält es sich oftmals so, dass keine Signifikanzen errechnet werden können. Die Grafiken zeigen aber den Trend zu weniger Rauheit."
Ja, wie jetzt, erst wird eine wissenschaftliche Studie entworfen, dann hart statistisch getestet, um zu überprüfen, ob ein Effekt echt ist oder mit großer Wahrscheinlichkeit Zufall. Dann sagt der statistische Test: Nö, ist Zufall. Und dann wird einfach gesagt: Na egal, der Trend ist ja zu erkennen.
Hallo?! Da kann der Effekt, wenn es ihn denn gibt, nicht all zu groß sein, sagt einem da unser statistisches Fachwissen (
Danke, Herr Wilm)
Aber nehmen wir mal an, Fachinger, nein, Frau Kerscher und ihre Mitarbeiter hätten mehr Personen genommen, und es wäre alles signifikant geworden. Vielleicht hätten die Personen auch einfach nur mehr (noch mehr) trinken müssen?
Wie auch immer. Wenn das alles so geklappt hätte und signifikant raus gekommen wäre. Was sagte uns das dann?
Sagte uns das: Staatl. Fachingen könnte toll für die Haut sein?
Klar.
Sagte uns das: Staatl. Fachingen könnte toller für die Haut sein als andere Wässer oder schnödes Leitungswasser?
Nein.
Denn dann hätte man Kontrollgruppen haben müssen, die Leitungswasser und andere Wässer trinken müssen (Apollinaris, Gerolsteiner, Bonaqua usw.). Also eine Vergleichsstudie.
Frau Erbrich: "
Eine Vergleichsstudie ist geplant."
How, how, how! Wir sind gespannt. Und bis dahin, behaupten wir mal: Staatl. Fachingen ist nicht besser oder schlechter für die Haut als andere Wässer, dafür teurer.
Und: Schon mal darüber nachgedacht, was es heißt jeden Tag drei Flaschen oder mehr Wasser zu trinken?
Stellt Euch das mal vor. Nur für schöne Haut. Die zwar nicht weniger Falten hat, dafür aber praller und frischer aussieht, (wie misst man eigentlich
frischer aussehen?
Praller und frischer soll sie sein, weil die Hautdichte signifikant zugenommen hat).
However, wie es in wissenschaftlichen
Paper immer so schön heißt ...
... und: "
Further research is needed." (engl. für: Da muss noch mehr geforscht werden).
Liebe Fachinger, netter Versuch, aber ...
Wir machen erst mal Mittag.
Prost, Mahlzeit
(
Martin, machst Du mal die zwei Biere auf!!)
Nachtrag 1:
Ach so, vor lauter Erklärerei haben wir jetzt ganz vergessen: Auch wenn die Hautdichte signifikant zunimmt: Alles andere hat sich nach vier Wochen staatlicher Trinkkur nicht verändert (Trends gibt es nicht in der Statistik). Die Werbung verspricht mal wieder mehr als sie halten kann. Das nötigt uns gerade zu, auch wenn es uns wirklich immer wieder weh tut (
nicht wirklich).
Stimmt mit uns ein für
Staatl. Fachingen, das Wasser, das glaubte: "Warum eincremen, wenn man es trinken kann!" in ein welt- und markerschütterndes, bis in die Marketinghallen in Fachingen an der Lahn (eigentlich der
MSH AND MORE Werbeagentur GmbH in Köln) schallendes:
 !PLAZEBOALARM!
Nachtrag 2:
!PLAZEBOALARM!
Nachtrag 2:
Liebe Fachinger,
macht doch einfach nochmal eine Studie mit mehr Probanden, damit auch die nötige "Power" erreicht wird (
Die Statistiker unter unseren Lesern wissen, was gemeint ist.) - vielleicht bei der Vergleichsstudie ...
...........................................................................................